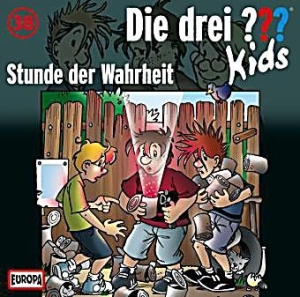Es ist auf diesem Blog gute alte Sitte, dass ich die Konzepte zu neuen Kapiteln für mein Buch Psychopharmakotherapie griffbereit hier veröffentliche und euch um euer konstruktives Feedback bitte. Lest das Kapitel, schreibt in die Kommentare, was verständlich erklärt ist, was schlecht erklärt ist, was vielleicht falsch ist und was fehlt!
Dieses Vorgehen hilft ungemein dabei, gute und richtige Texte zu erstellen, die es dann später in die nächste Auflage des Buches schaffen (die ist aber noch lange nicht in Sicht, die aktuelle ist ja noch recht neu!). Dieser Text steht daher ausnahmsweise unter Copyright, ihr dürft ihn also nicht weiterverwenden.
Und noch was: Ein YouTube Video zu diesem Inhalt gibt es nun auch, das findet ihr hier:
Also: Das ist mein Vorschlag; und nun bitte ich euch um euer Feedback!
8 ADHS-Therapeutika
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Zunehmend wird sie auch im Erwachsenenalter diagnostiziert. Dies kann entweder darauf zurückzuführen sein, dass ein Patient bereits im Kindes- oder Jugendalter mit ADHS diagnostiziert und behandelt wurde, und diese Behandlung nun im Erwachsenenalter fortgeführt wird, oder darauf, dass die Diagnose erst im Erwachsenenalter gestellt wird. Auch dann muss die Symptomatik bereits in der Kindheit bestanden haben, um die Diagnose zu rechtfertigen.
In Deutschland werden vier Substanzen häufig eingesetzt: Zur Gruppe der Stimulanzien gehören Methylphenidat und Lisdexamfetamin. Diese beiden haben insbesondere bei missbräuchlicher Verwendung ein Abhängigkeitspotenzial und unterliegen daher der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung. Dies soll einen sorglosen Gebrauch verhindern und die Verbreitung auf dem Schwarzmarkt einschränken. Viele Patienten und Eltern befürchten nun, dass das junge Gehirn des Patienten durch süchtig machende Substanzen geschädigt werden könnte. Tatsächlich verhindert die langsame Wirkungsentfaltung dieser Medikamente ein „high“. Auch eine Toleranzentwicklung ist selten. Das Missbrauchsrisiko bei Stimulanzien besteht vor allem bei nasaler Applikation und höheren Dosierungen, die im Rahmen der ADHS-Behandlung nicht vorgesehen sind. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist das Abhängigkeitspotential von Methylphenidat und Lisdexamfetamin niedrig.
Nicht aus der Gruppe der Stimulanzien sind das Antidepressivum Atomoxetinund Guanfacin. Die Wirkung auf die ADHS-Symptomatik ist bei diesen beiden Substanzen in den meisten Fällen schwächer als bei den Stimulanzien, dafür gehen sie nicht mit einem Mißbrauchspotential einher, unterliegen nicht der Betäubungsmittel-Verschreibungs-Verordnung und haben in bestimmten Indikationen ein besseres Profil als die Stimulanzien.
Zur Diagnostik und zum Gesamtbehandlungskonzept bei ADHS gibt es viel zu sagen. Ich verweise hier auf die sehr gute S3-Leitlinie „Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend und Erwachsenenalter“ 71. In diesem Buch konzentrieren wir uns auf die Substanzen und deren direkte Charakteristika.
8.1 Methylphenidat
- gehört zu den amphetaminähnlichen Substanzen und hat wie diese eine anregende Wirkung. Es unterdrückt Hunger und Müdigkeit.
- gilt als die Therapie der ersten Wahl der ADHS.
- führt oft zu einer eindrucksvollen Verbesserung der Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit und zu einer Verhaltensnormalisierung des betroffenen Kindes.
- kann auch bei Erwachsenen eingesetzt werden, die als Kind eine ADHS hatten und immer noch unter ausgeprägten Symptomen leiden.
Methylphenidat wurde erstmals 1944 von Leandro Panizzon, einem Angestellten der schweizerischen Firma Ciba (heute Novartis), synthetisiert. Zur damaligen Zeit war es üblich, Selbstversuche mit neu entwickelten Substanzen durchzuführen – so probierten Leandro Panizzon und seine Ehefrau Marguerite („Rita“) Methylphenidat aus. Besonders beeindruckt war Marguerite davon, dass sich ihre Leistung im Tennisspiel nach Einnahme von Methylphenidat steigerte. Von ihrem Spitznamen Rita leitet sich der bekannte Präparatename Ritalin® für Methylphenidat ab. Ritalin wurde 1954 von Ciba auf dem deutschsprachigen Markt eingeführt. Das Medikament wurde in Deutschland zunächst rezeptfrei abgegeben, erst 1971 wurde es dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt.
Methylphenidat ist ein umstrittenes Psychopharmakon. Das verwundert nicht, denn es gehört pharmakologisch zur Gruppe der amphetaminähnlichen Substanzen, und es wird Kindern und Jugendlichen verordnet. Dieser Gedanke kann einen zunächst einmal berechtigt irritieren. Ausgerechnet das noch in Entwicklung befindliche kindliche Gehirn mit einer Droge zu behandeln, nur weil das Kind „etwas zappelig“ ist, das kann doch nicht richtig sein; das muss doch Langzeitschäden verursachen.
Auf der anderen Seite beschreiben Betroffene und deren Eltern in vielen Fällen, dass das ADHS-kranke Kind vor der Medikation, trotz aller Psychotherapie, Beratung der Eltern und des Kindergartens/der Schule, Selbstmanagementkursen und alternativer Ernährung keine 3 Minuten bei einem Thema bleiben konnte, ständig durch die Gegend lief und nicht ruhig auf einem Stuhl sitzen konnte. In der Schule hätte es keinen Anschluss an Gleichaltrige gefunden. Mit der Medikation sei das Kind dann plötzlich in der Lage gewesen, sich über eine längere Zeit zu konzentrieren, habe ganz normal am Unterricht teilnehmen können und sei im Verhalten wieder so geworden, dass es nicht wie unter Strom stehend, sondern eben wieder gesund gewirkt habe.
Anders als Amphetamin setzt Methylphenidat seinen Wirkstoff langsam frei. Dadurch entsteht kein „high“ in der Wirkung und dies ist ein wesentlicher Punkt, warum die Abhängigkeitsgefahr ganz anders einzuschätzen ist als bei auf der Straße zum Rauschkonsum erhältlichen Amphetaminen. Es wird nun schon seit langer Zeit verordnet und es ist bislang nicht beobachtet worden, dass Kinder, die in ihrer Grundschulzeit Methylphenidat verordnet bekamen, später häufiger eine Amphetaminabhängigkeit entwickelt hätten. Es ist auch nicht bekannt, dass mit Methylphenidat behandelte Kinder später in ihrem Leben mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eine andere Abhängigkeit entwickelten. Vielmehr trifft sogar das Gegenteil zu: Die Behandlung einer ADHS mit Psychostimulanzien führte im Vergleich zur fehlenden Behandlung zu einem geringeren Risiko, eine Suchterkrankung zu entwickeln (Asherson P (2017) Drug Treatment for ADHD reduce risk of substance use disorder. Am J Psychiatry 174(9): 827-828).
Umgekehrt ist es schon so, dass Amphetaminabhängige nicht selten zu einem oder mehreren Psychiatern gehen und über genau die Symptome einer ADHS-Erkrankung klagen, die in Wikipedia stehen, in der oft erfolgreichen Absicht, Methylphenidat rezeptiert zu bekommen.
Es gibt auch immer wieder ADHS-Patienten, die in einer Art „Selbstmedikation“ Amphetamine einnehmen. Die Diagnose einer ADHS bei bestehender Amphetaminabhängigkeit ist schwierig. Gerade von Suchttherapeuten wird Methylphenidat in der retardierten Form aber auch abhängigen ADHS-Patienten verordnet, mit dem Argument, so der Entwicklung oder Ausdehnung einer Amphetaminabhängigkeit vorzubeugen.
8.1.1 Pharmakologie
Methylphenidat gehört zu den Phenethylaminen und ist, wie auch das Amphetamin, ein indirektes Sympathomimetikum mit zentraler Wirkung. Die chemische Struktur ähnelt den Katecholaminen. Methylphenidat wirkt anregend und aufregend. Es unterdrückt Müdigkeit und Hunger und steigert kurzfristig die körperliche Leistungsfähigkeit. Normalerweise bei körperlicher Überlastung auftretende Warnsignale wie Schmerz und Erschöpfungsgefühl werden vermindert.
Methylphenidat ist ein Dopamin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. In geringem Maße sorgt es für die Freisetzung von Katecholaminen, die erhöhte Dopaminkonzentration wird aber in erster Linie durch Wiederaufnahmehemmung erreicht. Methylphenidat wirkt außerdem als Agonist an den Serotoninrezeptoren 5-HT1A und 5-HT2B.
Methylphenidat wird rasch und fast vollständig resorbiert. Die maximale Plasmakonzentration des unretardierten Wirkstoffs ist nach ca. 1–2 Stunden erreicht. Die Wirkdauer beträgt ca. 4 Stunden. Für die Aufdosierung und Dosisfindung fängt man häufig mit dem unretardierten Methylphenidat an.
Es gibt Methylphenidat auch retardiert, dann ist die Wirkstofffreisetzung auf bis zu 12 Stunden verzögert.
Und schließlich gibt es Präparate, die einen Teil des Wirkstoffs retardiert und einen anderen Teil unretardiert enthalten. So wird der Wirkstoff bei morgendlicher Einnahme in einem günstigen Profil über den Tag verteilt freigesetzt.
Für die Erwachsenenpsychiatrie sind nur Retardpräparate zugelassen. Das liegt zum einen daran, dass unretardiertes Methylphenidat ein höheres Missbrauchspotential hat und zum zweiten daran, dass die Wirkstofffreisetzung über den Tag bei den Retardtabletten besser ist.
8.1.2 Klinischer Einsatz
Methylphenidat ist im Rahmen einer therapeutischen Gesamtstrategie zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen bei Kindern ab einem Alter von 6 Jahren angezeigt, wenn sich andere therapeutische Maßnahmen allein als unzureichend erwiesen haben. Die Diagnose darf sich nicht allein auf das Vorhandensein von Symptomen stützen, sondern muss auf einer vollständigen Anamnese und Untersuchung des Patienten basieren. Eine therapeutische Gesamtstrategie beinhaltet sowohl psychologische, pädagogische, soziale als auch medikamentöse Maßnahmen. Einmal pro Jahr soll man einen kontrollierten Auslassversuch machen.
Dosierung
- Immer schrittweise aufdosieren
- bei Kindern mit 5-10 mg beginnen
- Typische Dosis für Kinder und Jugendliche: 20–40 mg pro Tag (1 mg pro kg Körpergewicht)
- Typische Dosis für Erwachsene: 40–60 mg pro Tag
- Zugelassene Tageshöchstdosis Erwachsene: 80 mg
Wenn man sich für Methylphenidat entschieden hat, und die Wirkung zwar vorhanden ist, aber nicht gut über den Tag verteilt anhält, kann es hilfreich sein, die Dosis auf zwei Zeitpunkte aufzuteilen (morgens und mittags) oder auf ein anderes Präparat umzustellen, dass einen anderen Teil der Dosis als Retardformulierung enthält.
Es gibt nicht wenige Patienten, die das Medikament nur während der Woche nehmen (Schule/Arbeit), es aber am Wochenende oder im Urlaub weglassen oder reduzieren, da sie es in diesen Situationen weniger brauchen. Das funktioniert erfahrungsgemäß problemlos und mit dem ersten Tag der Woche und der normal eingenommenen Dosis stellt sich auch wieder die gewohnte Wirkung ein.
8.1.3 Nebenwirkungen
Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Nervosität. Aus dem psychiatrischen Bereich sind die Nebenwirkungen Appetithemmung, Affektlabilität, Aggression, Unruhe, Angst und Reizbarkeit häufig. Gelegentlich kommt es zu psychotischen Störungen sowie akustischen, optischen und taktilen Halluzinationen. Methylphenidat kann eine Reihe weiterer relevanter Nebenwirkungen an verschiedenen Organsystemen verursachen, über die die Fachinformation informiert.
Bei Kindern und Jugendlichen kann es gelegentlich zu einer Wachstumsverzögerung kommen.
Patienten mit Krampfanfällen in der Vorgeschichte soll man keine Stimulanzien verordnen, da diese die Krampfschwelle erheblich senken können.
8.2 Lisdexamfetamin
Lisdexamfetamin ist in Deutschland seit 2013 für die Behandlung von ADHS bei Kindern ab sechs Jahren zugelassen. 2019 wurde die Zulassung auf erwachsene Patienten erweitert.
Lisdexamfetamin gilt als sehr gut wirksam, aber nebenwirkungsreicher als Methylphenidat, daher wird es häufig als Medikament der zweiten Wahl eingesetzt, wenn Methylphenidat nicht ausreichend gewirkt hat. Zugelassen ist es aber auch als Mittel der ersten Wahl, unter bestimmten Bedingungen.
8.2.1 Pharmakologie
Lisdexamfetamin ist ein Prodrug, das im Körper zu seinem aktiven Bestandteil Dextroamphetamin metabolisiert wird. Dextroamphetamin erhöht die Freisetzung von Neurotransmittern wie Dopamin und Noradrenalin. Da Lisdexamfetamin als Prodrug langsamer aktiviert wird, ist das Risiko von Missbrauch im Vergleich zu direkteren Formen von Amphetaminen niedriger.
8.2.2 Klinischer Einsatz
Lisdexamfetamin ist zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern ab sechs Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen zugelassen.
Darüber gibt es Hinweise, dass Lisdexamfetamin bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Binge-Eating-Störung (BES) hilft, die Häufigkeit von Essanfällen zu reduzieren (JAMA Psychiatry (2015; doi: 10.1001/jamapsychiatry.2014.2162). In den USA ist es seit 2015 in dieser Indikation auch zugelassen, in Deutschland nicht.
8.2.3 Dosierung
Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 30 mg pro Tag. Je nach klinischem Bild kann die Dosis wöchentlich um 10 mg gesteigert werden. Die Zieldosierungen für Erwachsene liegen bei 20 mg pro Tag bis maximal 70 mg pro Tag.
8.2.4 Unerwünschte Wirkungen
Stimulanzien rufen einen geringfügigen Anstieg des durchschnittlichen Blutdrucks (um etwa 2 – 4 mmHg) und der durchschnittlichen Herzfrequenz (um etwa 3 – 6 Schläge/min) hervor, und im Einzelfall kann es auch zu stärkeren Anstiegen kommen (Quelle Fachinformation Elvanse®). Bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, insbesondere bei angeborene Herzfehler, Herzrhythmusstörungen und Hypertonie ist eine individuelle Nutzen-Risiko-Einschätzung erforderlich.
Die Appetitminderung ist unter Lisdexamfetamin oft ausgeprägter als unter Methylphenidat.
8.3 Atomoxetin
- ist ein Antidepressivum, genauer gesagt ein selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer.
- hat keine Ähnlichkeit mit Amphetaminen, unterliegt nicht dem Betäubungsmittelgesetz und kann wie jedes Antidepressivum auf einem ganz normalen Rezept verordnet werden.
- ist zugelassen als ADHS-Therapeutikum der ersten Wahl.
- ist im Erwachsenenalter bei begleitenden Abhängigkeitserkrankungen, Angst- oder Tic-Störungen Mittel der ersten Wahl.
Atomoxetin ähnelt chemisch dem Fluoxetin, ist aber anders als dieses kein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, sondern ein selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Dieses Therapieprinzip hat sich in der Behandlung von Depressionen als nicht wirksam erwiesen. Es ist aber seit 2005 in Deutschland zugelassen zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS).
8.3.1 Pharmakologie
Atomoxetin ist ein Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer ohne wesentliche Wirkung auf die Serotonin-Wiederaufnahmehemmung. Durch die Hemmung des Noradrenalintransporters, der nicht ganz so selektiv arbeitet, kommt es auch zu einem Anstieg von Dopamin im präfrontalen Kortex.
Atomoxetin ist kein Psychostimulans. Die Wirkung tritt im Gegensatz zu den Stimulanzien erst nach mehreren Wochen auf.
8.3.2 Klinischer Einsatz
Atomoxetin ist in Deutschland zur Behandlung der ADHS bei Kindern ab dem sechsten Lebensjahr, bei Jugendlichen und bei Erwachsenen zugelassen. Erwachsene dürfen nur dann mit Atomoxetin behandelt werden, wenn die ADHS-Symptome schon in der Kindheit vorhanden waren. Da Atomoxetin kein Psychostimulans ist, kann es auch Patienten mit einer vorbestehenden oder komorbiden Suchterkrankung verordnet werden und ist für diese Patientengruppe die Therapie der ersten Wahl. Auch bei komorbiden Angst- oder Tic-Störungen ist es gegenüber dem Methylphenidat zu bevorzugen.
8.3.3 Dosierung
- Kinder und Jugendliche bis 70 kg Körpergewicht:
- Anfangsdosis während der 1. Woche: 0,5 mg/kg Körpergewicht
- Dauerbehandlung ab der 2. Woche: Bis zu 1,2 mg/kg Körpergewicht
- Erwachsene und Jugendliche ab 70 kg Körpergewicht:
- Anfangsdosis während der 1. Woche: 40 mg/Tag
- Dauerbehandlung ab der 2. Woche: je nach Wirksamkeit und Verträglichkeit bis zu 80-100 mg/Tag
8.3.4 Nebenwirkungen
Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer können sowohl den Puls als auch den Blutdruck ansteigen lassen. Dies gilt auch für Atomoxetin. Es kann auch eine gewisse Unruhe verursachen. Ansonsten gilt es als relativ gut verträglich.
8.4 Guanfacin
Guanfacin ist kein Stimulans. Es ist ein alpha2A-adrenerger Rezeptor-Agonist, der die postsynaptische noradrenalin-Übertragung modifiziert. Guanfacin ist in Deutschland für Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche zugelassen; für Erwachsene ist es anders als in den USA in Deutschland nicht zugelassen.
Guanfacin kann eingesetzt werden, wenn Stimulanzien nicht in Betracht kommen oder nicht wirksam waren. Die Wirkung tritt üblicherweise innerhalb von 3 Wochen ein.
Guanfacin wirkt in vielen Fällen schwächer als Stimulanzien, auch kann es Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme machen. Wenn Stimulanzien aber nicht erfolgreich waren oder sich aus anderen Gründen nicht anbieten, ist es im Bereich der Kinder- und Jugendlichen Psychiatrie eine weitere Behandlungsoption.
8.5 Mein persönliches Fazit zu ADHS Therapeutika
„Vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gestellt“. Dies gilt insbesondere für Methylphenidat. Es wirkt bei Kindern mit ADHS sehr effektiv, auch noch im Erwachsenenalter, wenn die Symptomatik unbehandelt fortbestehen würde. Allerdings gibt es auch Fehldiagnosen; nicht jeder unkonzentrierte Erwachsene hat ADHS.
Methylphenidat ist das Mittel der ersten Wahl bei ADHS, seine Wirksamkeit ist unbestritten. Die Frage nach dem Abhängigkeitspotential ist zwar nicht einfach zu beantworten, aber bislang gibt es keine Studien, die ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Suchtkrankheit nach Behandlung mit Methylphenidat zeigen. Anders ist es, wenn die Suchtkrankheit vor einem Behandlungsversuch mit Methylphenidat besteht, dann ist besondere Vorsicht geboten.
Lisdexamfetamin gilt als Mittel der zweiten Wahl. Bei Kindern und Jugendlichen ist bei der Indikation sogar explizit gefordert, dass ein Versuch mit Methylphenidat zuvor erfolglos gewesen sein muss. Es kann mehr Nebenwirkungen haben als Methylphenidat, insbesondere die Appetitminderung kann ausgeprägter sein. Allerdings hilft Lisdexamfetamin manchen Patienten, die unter Methylphenidat keine ausreichende Wirkung haben, besser.
Atomoxetin ist zwar weniger bedenklich als Methylphenidat, aber für manche Patienten auch weniger wirksam. Es ist vor allem dann eine Option, wenn es gute Gründe gibt, kein Methylphenidat einzusetzen. Man muss aber wissen, dass die Wirkung von Atomoxetin im Gegensatz zu den Stimulanzien erst nach einigen Wochen eintritt.
Guanfacin ist nur für Kinder und Jugendliche zugelassen und hat hier eine besondere Bedeutung bei Unverträglichkeit gegen Stimulanzien.
Literatur
70 Lilly Deutschland GmbH. Rote-Hand-Brief. Wichtige sicherheitsrelevante Information zu Strattera (Atomoxetin) und des Risikos eines Blutdruck- und Herzfrequenzanstiegs (07.12.2011). Im Internet: http://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/RHB/Archiv/2011/20111207.pdf; Stand: 09.02.2020
Weiterführende Literatur
71 dgkjp e. V., DGPPN e. V., DGSPJ e. V. et al. Kurzfassung der interdisziplinären evidenz- und konsensbasierten (S3) Leitlinie „Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter“ (05/2017). Im Internet: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/028-045k_S3_ADHS_2018-06.pdf; Stand: 11.03.2020
Copyright
Dieser Beitrag ist ein Auszug beziehungsweise eine auszugsweise Vorabveröffentlichung des Werks „Psychopharmakotherapie griffbereit“ von Dr. Jan Dreher, © Georg Thieme Verlag KG. Die ausschließlichen Nutzungsrechte liegen beim Verlag. Bitte wenden Sie sich an permissions@thieme.de, sofern Sie den Beitrag weiterverwenden möchten.